IP-Videokameras von Mobotix auf der Zugspitze
Unterhalb der Zugspitze auf einer Höhe von 2.650 Metern steht das Schneefernhaus, ein im Jahr 1931 erbautes ehemaliges Hotel, das seinen Namen dem größten bayrischen Gletscher ver...



Unterhalb der Zugspitze auf einer Höhe von 2.650 Metern steht das Schneefernhaus, ein im Jahr 1931 erbautes ehemaliges Hotel, das seinen Namen dem größten bayrischen Gletscher verdankt. Heute dient das Schneefernhaus als Umweltforschungsstation (UFS), an der sich Wissenschaftler mit der kontinuierlichen Beobachtung physikalischer und chemischer Eigenschaften der Atmosphäre beschäftigen.
Dort werden unter klirrender Kälte und Frost bei Temperaturen von bis zu minus 30°C wetter- und klimawirksame Prozesse analysiert, die grundlegend sind für die Beschreibung von Zustand und Entwicklung des weltweiten Klimas. Wenn es um die Qualitätskontrolle der Messdaten geht, vertrauen die Wissenschaftler auf robuste IP-Videokameras des deutschen Herstellers Mobotix.
Untersuchung der globalen Schneefallverteilung
Die UFS Schneefernhaus steht unter der Leitung des Bayrischen Umweltministeriums und bietet Forschungsinstituten die Möglichkeit, dort ihrer Wissenschaft nachzugehen. Einer der Forschungspartner ist das Institut für Geophysik und Meteorologie der Universität zu Köln. Der Forschungsschwerpunkt des Instituts liegt auf Wolkenfernerkundung mittels Mikrowellenradiometrie. Darunter versteht man einerseits die Beobachtung atmosphärischer Parameter wie etwa die vertikale Verteilung von Temperatur und Feuchte als auch andererseits Informationen über den Schnee- und Wassergehalt von Wolken mit Auflösung im Sekundentakt. Diese Parameter lassen sich mithilfe sogenannter passiver Mikrowellenradiometer bestimmen. „Mikrowellenradiometer sind hochempfindliche Empfänger für Mikrowellenstrahlung", erklärt Dr. Stefan Kneifel. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Geophysik und Meteorologie der Universität zu Köln und arbeitet an der UFS am Tosca-Projekt. Die Forschungsgruppe untersucht in langjährigen Beobachtungsreihen den Flüssigwasser- und Schneegehalt von Wolken. In den polaren Gebieten ist eine rapide Veränderung des Wasserkreislaufs festzustellen. Aus diesem Grund ist die Kenntnis der globalen Schneefallverteilung von besonderer Bedeutung für Klimastudien.
Exakte Forschungsergebnisse in 2.650 Metern Höhe
Doch die Untersuchung der mikrophysikalischen Eigenschaften fallenden Schnees ist ein komplexes Unterfangen, das eine äußerst präzise Forschung und sorgfältige Auswertung sowie Qualitätskontrolle der Messdaten erfordert. „Die Mikrowellenradiometer messen durch ein Messfenster im Gehäuse des Gerätes nach außen, welches aus speziellem Schaumstoff besteht", erklärt Kneifel. „Es ist wichtig, dass dieses Messfenster trocken bleibt. Sobald sich dort Schnee, Eis oder Wassertropfen ansammeln, werden die Messungen unbrauchbar." Um solche Situationen aufzudecken und die Daten im Nachhinein entsprechend filtern zu können, musste eine Lösung gefunden werden. Nach intensiver Recherche fiel die Wahl auf ein IP-Videosystem des Kameraherstellers Mobotix.
Spezielle Anforderungen bei widrigen Bedingungen
Das Videosystem war neuartig an der Forschungsstation. Zuvor gab es keine Kameralösung, die die Arbeit des Tosca-Projekts unterstützte. Aufgrund der speziellen Wetter- und Arbeitsbedingungen an der Forschungsstation sind die Anforderungen an ein Videosystem jedoch sehr hoch. Neben Robustheit, die jeglichem Wetter standhält, ist auch Langlebigkeit der Kameras ein wichtiges Kriterium. Da die Forschungsarbeiten sowohl am Tage als auch in der Nacht durchgeführt werden, müssen die Kameras eine hohe Lichtempfindlichkeit besitzen. „Für die verschiedenen Beobachtungsbereiche brauchen wir für unsere Kameras auch eine variable Auswahl an Objektiven, die sich flexibel je nach Bedarf austauschen lassen", so Kneifel. Die IP-Videokameras erfüllen alle Anforderungen, die für die Forschungsarbeiten an der Zugspitze notwendig sind.
Normalerweise liefern Kameras nur die Bilder; die Verarbeitung und Aufzeichnung erfolgt nachgeordnet auf einem zentralen PC. Das erfordert jedoch ein hochperformant ausgelegtes Netzwerk, das nicht immer - wie beispielsweise am Schneefernhaus in 2.650 Metern Höhe - verfügbar ist. Zudem reicht eine PC-Rechenleistung für mehrere hochauflösende Kameras in der Regel nicht aus. Auszeichnend für Mobotix ist das dezentrale Konzept, das dieses Problem umgeht. In jede Kamera ist ein Hochleistungsrechner und bei Bedarf ein digitaler Langzeit-Flashplayer in Form einer MicroSD-Karte zur mehrtägigen Aufzeichnung integriert. Die Verarbeitung der hochauflösenden Bilder geschieht in der Kamera selbst; sie müssen nicht andauernd zur Auswertung transportiert werden - der PC wird nur noch zum Anschauen benötigt. Ein großzügig ausgelegtes Netzwerk ist somit nicht mehr erforderlich.
Die erste Kamera für die Überwachung der Mikrowellenradiometer an der UFS Schneefernhaus wurde 2007 installiert. Die Mobotix M1 wurde ausschließlich für die Kontrolle der Messungen am Tage eingesetzt, eine Nachtbeobachtung war zu diesem Zeitpunkt nicht geplant.
Seit 2008 gibt es an der UFS noch eine zweite Kamera, die die kostspieligen und hochsensiblen Messgeräte im Blick hat. Die M22 besitzt zwei separate Bildsensoren, die sowohl für Tag- als auch für Nachtaufnahmen eine hohe Bildauflösung garantieren und eignet sich daher bestens, die Forschung auch bei Dunkelheit zu überwachen. „Zusätzlich haben wir zur Beleuchtung einen LED-Schweinwerfer installiert. Das garantiert, dass wir auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer klare Sicht haben, denn unsere Messungen laufen auch in den Nachtstunden weiter", erläutert Kneifel. Zudem speichert diese Kamera bis zu 30 hochauflösende Live-Bilder pro Sekunde inklusive Ton. Zum Vergleich: Ein Kinofilm zeigt lediglich 24 Bilder pro Sekunde. Die detailgetreuen Aufnahmen der Kamera lassen selbst die winzigsten Flüssigkeitstropfen in hochauflösender Bildqualität sichtbar werden. „Wo das menschliche Auge auf den ersten Blick versagt, hilft uns die Kamera dabei, Klarheit zu schaffen. Sie trägt dazu bei, eine hohe Qualität unserer Messdaten zu garantieren", so Stefan Kneifel weiter. Die Kameras wurden direkt vor den Messgeräten positioniert. So kann sowohl das Messfenster optimal überwacht als auch der Himmel mit beobachtet werden, um Wettersituation und Sichtweite festzustellen.
Eine weitere Kamera, die M24, ist seit 2010 am Forschungszentrum Jülich im Rahmen des „Jülich Observatory for Cloud Evolution" (JOYCE) in Betrieb. Auch diese Einrichtung wird unter anderem von der Universität Köln geleitet und befasst sich mit der Struktur von Wolken und deren Zusammensetzung. Das Besondere an dieser Kamera ist die freie Objektivwahl inklusive 180°-Panoramaversion.
Alle eingesetzten Kameras arbeiten bei widrigsten Wetterbedingungen. Sie sind robust, wetterfest von -30°C bis +60°C und ermöglichen digitales stufenloses Zoomen, Schwenken und Neigen. Da sie ganz ohne mechanische Teile auskommen, reduziert sich die Wartung auf ein Minimum. Die Mobotix-Netzwerkkameras können den Strom mittels Power over Ethernet oder auch über das ISDN-Kabel beziehen. Der geringe Stromverbrauch von weniger als fünf Watt bringt nicht nur Kostenvorteile mit sich, sondern schont vor allem im Sinne von „grüner IT" die Umwelt. Per Script werden die Kamerabilder alle fünf Minuten von der Kamera geholt und dann via Internet zur Universität Köln zur Auswertung und Archivierung geschickt.
Zweck des Videosystems ist es, die Forschungsarbeiten zu überwachen und die Messgeräte im Blick zu behalten, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse korrekt sind. Unbrauchbare Messungen, die mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen sind, können durch die Videoaufnahmen sofort gefiltert werden. Dieser Vorgang spart Dr. Stefan Kneifel und seinem Team eine Menge Arbeit und Zeit. Auch in Anbetracht der widrigen Arbeitsbedingungen an der Zugspitze ist das Videosystem eine Entlastung für die Forscher, die am Tosca-Projekt an der UFS Schneefernhaus arbeiten.
Meist gelesen
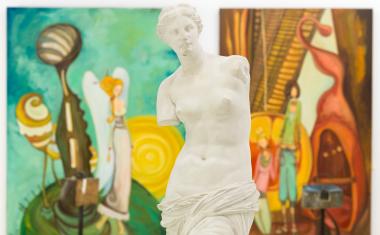
Videoüberwachung im Museum: Datenschutz und Kameraauswahl
Sicherheit für Kulturgüter ist - auch angesichts des Diebstahls im Pariser Louvre - ein wichtiges Thema. Von großer Bedeutung: die Überwachung mittels Videotechnik. Ein Beitrag darüber, was dabei zu beachten ist.

Neubau der JVA Münster: BLB NRW setzt neue Maßstäbe für Sicherheit, Resozialisierung und moderne Haftanstalten
Neubau der JVA Münster: Moderne Haftanstalt mit Fokus auf Sicherheit, Resozialisierung und Humanität

Sicherheit für die Deutsche Bahn – Interview mit Britta Zur
Britta Zur hat zum 31. Oktober 2025 den Vorsitz der Geschäftsführung bei DB Sicherheit niedergelegt. Das Interview führte GIT SICHERHEIT im Frühjahr 2025.

Sicherheit im Ernstfall: Wie Unternehmen mit strategischem Personenschutz und Amokprävention Verantwortung übernehmen
Personenschutz & Amokprävention: Strategische Konzepte, Training & Verantwortung für Unternehmenssicherheit

Video-Sicherheit & Video-Management: Die Gewinner der Kategorie C beim GIT SICHERHEIT AWARD 2026
GIT SICHERHEIT AWARD 2026: Video-Sicherheit & Video-Management – die innovativsten Lösungen im Überblick






