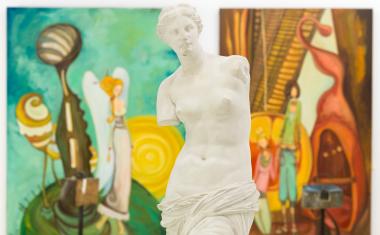Cannabis im Arbeitsalltag - Wie Speicheltests die Arbeitssicherheit verbessern
Seit dem 01. April 2024 ist das sogenannte Cannabisgesetz in Deutschland in Kraft. Die Teillegalisierung von Cannabis führte seitdem zu neuen Herausforderungen im Bereich der Arbeitssicherheit. Neben fehlenden kostengünstigen und massentauglichen Testverfahren, mangelt es auch an rechtlichen Grundlagen. Daniel Budde, Marketing-Manager für Drogen- und Alkoholmesstechnik bei Dräger, erläutert, welche Regelungen gegenwärtig bestehen, vor welche Herausforderungen sich die Arbeitssicherheit gestellt sieht und welche Rolle Speicheltests dabei spielen können.


GIT SICHERHEIT: Herr Budde, bisher gibt es immer noch relativ wenig Erfahrung im Umgang mit Cannabis, gerade wenn es um das Thema Grenzwerte und Tests geht. Der Straßenverkehr erfüllt gegenwärtig eine gewisse Vorreiterfunktion, da hier ein THC-Grenzwert gesetzlich festgeschrieben ist. Vor der Teillegalisierung kamen vor allem Urin- und/oder Bluttests zur Anwendung. Welche grundsätzlichen Vorteile bieten dem gegenüber Speicheltests?
Daniel Budde: Nach dem Konsum von Cannabis ist eine Person durchschnittlich für etwa 6 Stunden beeinträchtigt. Vor diesem Hintergrund sind Speichelschnelltests im Vergleich zu den traditionell verwendeten Urintests die zuverlässigere Testmethode. Speicheltests messen nämlich, was sich zum Zeitpunkt des Tests gerade im Mund, also im Körper, befindet. Somit lässt sich mit diesem Test feststellen, inwieweit eine Person noch unter dem psychoaktiven Einfluss von THC steht oder nicht. Zudem sind die Speicheltests weniger invasiv als Urin- oder Bluttests und greifen nicht so stark in die Privatsphäre der getesteten Person ein. Hinzu kommt die Zeitersparnis: Fünf bis sechs Substanzen sind nach fünf Minuten nachweisbar und bei Unsicherheiten kann nochmals getestet werden. Das Verfahren lässt sich auch durch Mundspülungen oder ähnliches nicht beeinflussen und stellt daher aus meiner Sicht einen sinnvollen Technologiewechsel dar.
Im Vorgespräch zu diesem Interview, haben sie u. a. auf die sogenannte „Unempfindlichkeit“ von Drogentests verwiesen. Was genau ist damit gemeint?
Daniel Budde: Jeder positive Drogenschnelltest zieht einen Bestätigungstest nach sich. In den meisten Fällen ist das derzeit ein Bluttest. Das Ziel ist es natürlich, die Aufwände möglichst gering zu halten. Daher gilt es, falsch-positive Ergebnisse im Vortest möglichst zu vermeiden. Es kommt also auf die Spezifität und Sensitivität des Schnelltests an. Ein Test mit hoher Spezifität sorgt dafür, dass negative Testergebnisse korrekt identifiziert werden – er liefert also wenige falsch-positive Ergebnisse. Die Sensitivität eines Tests sorgt dafür, dass positive Ergebnisse korrekt identifiziert werden. Von Unempfindlichkeit spricht man auch, wenn ein Test nicht in der Lage ist, bestimmte Drogen oder deren Abbauprodukte in niedrigen Konzentrationen zu erkennen. Dann ist die Sensitivität des Tests zu gering.
Im Bereich der Arbeitssicherheit stehen Unternehmen gegenwärtig vor einem Dilemma: Einerseits greifen personenbezogene Kontrollen wie Alkohol- und Drogentests vor oder während der Arbeitszeit in das Persönlichkeitsrecht der Mitarbeitenden ein. Andererseits gehört es aber zur Aufsichtspflicht des Arbeitgebers, Ihre Mitarbeiter am Arbeitsplatz vor Gefahren und gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu schützen. Welche Möglichkeiten haben Unternehmen, entsprechende Tests festzulegen und wie sollte ihrer Erfahrung nach die Umsetzung gestaltet sein?
Daniel Budde: Wenn ein Unternehmen Alkohol- oder Drogentests einsetzen will, ist auf jeden Fall eine Betriebsvereinbarung notwendig – der Betriebsrat muss zustimmen. Zudem sollten Unternehmen sich einen Plan B überlegen, falls ein Mitarbeiter sich nicht mit einer solchen Messung einverstanden erklärt. Denn diese Tests erfolgen immer freiwillig. Im Verweigerungsfall gibt es die Möglichkeit, den betreffenden Mitarbeiter freizustellen, wenn man berechtigte Zweifel an seiner Arbeitsfähigkeit hat. Das generelle Vorgehen, um Kontrollen festzulegen, ist sehr unterschiedlich. Es gibt die Möglichkeit, aufgrund eines Verdachts zu testen und damit die Arbeitsfähigkeit zu prüfen. Manche Unternehmen testen aber auch nach dem Zufallsprinzip alle Mitarbeitenden, um eine Stigmatisierung zu vermeiden. Oder sie testen bei Schichtbeginn, zum Beispiel, bevor die Mitarbeitenden eine große Baustelle betreten. Passiert ein Unfall, kann mithilfe des Messverfahrens festgestellt werden, ob dabei Drogen im Spiel waren. Geht es darum, Risiken in gefährlichen Bereichen wie etwa in Ölraffinerien oder Kernkraftwerken zu verhindern, dann geschieht dies meist über Zugangskontrollen mit entsprechenden Messungen.
Gibt es Branchen die in besonderem Maße von der Teillegalisierung „betroffen“ sind?
Daniel Budde: Ja, das sind vor allem Unternehmen aus den Bereichen der kritischen Infrastruktur, Verkehr, Logistik, Gefahrgut und weitere Branchen, die ein erhöhtes Gefahrenpotenzial aufweisen. Nehmen Sie als Beispiel einen Mitarbeitenden, der unter Drogeneinfluss ein Flurförderzeug fährt und daraufhin andere verletzt. Das zu verhindern ist durch eine bloße Beobachtung von Menschen kaum möglich. Unternehmen müssen hier ihre Fürsorgepflicht erfüllen.

Seit 1953 hat Dräger Erfahrung im Umgang mit Alkoholtests. Weitaus weniger Erfahrung gibt es hingegen mit Cannabis. Welche Wege beschreitet Dräger, um seine Speicheltests im realen Einsatz zu testen?
Daniel Budde: Wir gewinnen die meisten Erkenntnisse aus dem Straßenverkehr. Dafür arbeiten wir eng mit Polizei und Ordnungsämtern zusammen, die zum Teil bei ihren Verkehrskontrollen bereits auf Speicheltests setzen. Auch hier beobachten wir den Technologiewechsel. Außerdem waren wir in den letzten Jahren auf Festivals wie dem Airbeat One mit einer eigenen Alkohol- und Drogenteststation vertreten. Wir haben den Besucherinnen und Besuchern Tests angeboten, vorrangig am letzten Festivaltag, damit sie nach dem Festival sicher nach Hause kommen ohne Substanzeinfluss.
Welche Erkenntnisse konnten dabei bisher gesammelt werden – insbesondere mit Blick auf die Grenzwert-Problematik?
Daniel Budde: Wir nutzen für den Nachweis von THC schon lange verschiedene Cut-Offs (Grenzwerte) im Speichel. Andere Länder haben andere Anforderungen als wir. Bei Cannabis bringt ein längeres Warten (Inkubationszeit mit Antikörpern) einen kleinen, empfindlichen Grenzwert. Mit der Änderung auf einen höheren Grenzwert im Straßenverkehrsgesetz sind schnelle Tests und höhere Grenzwerte treffsicherer. Dies zeigen erste Studien.
Werfen wir noch einen Blick in andere europäische Länder. Welche Tests kommen dort gegenwärtig zur Anwendung und welche Erfahrungen konnten dort bereits gesammelt werden?
Daniel Budde: Cannabis ist auf der ganzen Welt sehr verbreitet. Einige europäische Länder wie Belgien und Frankreich testen ebenfalls per Speichel, auch beim Bestätigungstest. Deutschland erprobt Speichel gegen Speichel und Speichel gegen Blut (Vortest versus Bestätigungstest).