Daten nach Zahlen! Ein Barometer soll das Maß staatlicher Überwachung dauerhaft erfassen
Wie lässt sich Überwachung quantitativ messen? Ralf Poscher, Direktor am Max-Planck-Institut, leitet ein Forschungsprojekt, das diese Frage beantworten soll.
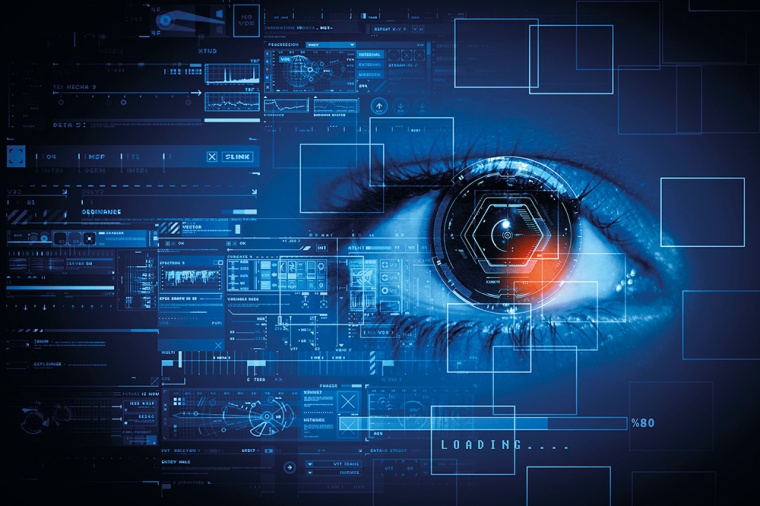
Überwachungstätigkeiten des Staates sollen mit Hilfe der durch die Digitalisierung eröffneten Möglichkeiten zahlenmäßig erfasst werden. Ein Überwachungsbarometer könnte die staatlichen Überwachungsmaßnahmen auf Dauer transparent machen. Der folgende Auszug aus dem Papier „Entwicklung eines periodischen Überwachungsbarometers für Deutschland“ skizziert, worum es den Forschern in dem mehrstufig angelegten Projekt geht.
Unter Anknüpfung an den verfassungsrechtlichen Topos einer „Überwachungsgesamtrechnung“ soll ein theoretisch und empirisch unterlegtes Konzept zur Entwicklung eines Instrumentariums zur Erfassung der realen Überwachungslast in Deutschland entwickelt und getestet werden. Hierfür sollen zunächst alle wesentlichen behördlichen Befugnisse zum Zugriff auf allgemeine Datenbestände zu Privatpersonen systematisch analysiert werden. Weiterhin sollen die Häufigkeit und ausgewählte qualitative Merkmale solcher Zugriffe und deren Bewertung auf der Grundlage (verfassungs-)rechtlicher und empirischer Parameter erfasst werden.
Überwachungslast in Deutschland
Bei der sog. Überwachungsgesamtrechnung (ÜGR) handelt es sich um einen bislang vorwiegend theoretisch diskutierten verfassungsrechtlichen Topos, welcher der Erfassung bzw. Abschätzung der – kumulierten – „Überwachungslast“ in Deutschland gilt.
Der Topos knüpft ursprünglich an das wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) aus dem Jahr 2010 zur Vorratsdatenspeicherung an. Dort erklärte das Gericht eine Vorratsdatenspeicherung im Bereich der Telekommunikation für Zwecke sowohl der Gefahrenabwehr als auch der Strafverfolgung grundsätzlich für zulässig, bewertete jedoch die konkrete Ausgestaltung der (damaligen) Regelungen im Telekommunikationsgesetz als verfassungswidrig.
Das BVerfG führte über diesen konkreten Einzelfall hinaus aus, dass der Gesetzgeber bei der Erwägung neuer Speicherpflichten und -berechtigungen im Hinblick auf die Gesamtheit der verschiedenen bereits existierenden Datensammlungen zukünftig zu größerer Zurückhaltung gezwungen sei. Daraus hat sich eine rechtspolitische Diskussion über die „Überwachungs-Gesamtrechnung“ entwickelt. Mit dem etwas sperrigen Begriff wird auf die Notwendigkeit einer auch empirisch unterlegten Gesamtbetrachtung des (jeweils aktuellen) Standes staatlicher Überwachung verwiesen, die alle verfügbaren staatlichen Überwachungsmaßnahmen quasi aufaddiert. Bislang gibt es allerdings noch keine Vorschläge, wie eine Überwachungsgesamtrechnung operationalisiert werden könnte.
Gewichtung nach Eingriffswirkung
Für ein solches Vorhaben erscheint es nicht hinreichend, Zugriffsnormen und Anwendungszahlen rein quantitativ zu erfassen. Überwachungsmaßnahmen und Zugriffe auf datenförmig hinterlegte Informationen müssen darüber hinaus auch näher spezifiziert und im Hinblick auf ihre Zielsetzung und ihre Eingriffswirkung gewichtet werden.
So dürfte beispielsweise ein nach abstrakter Bewertung eingriffsintensiver präventiver Echtzeit-Zugriff auf mobile Standortdaten einer in einem weitläufigen Waldgebiet vermissten Person oder ihrer Begleitung zur Abwendung einer konkreten Gefahr für Leib oder Leben anders zu bewerten sein als die repressive Abfrage von Kontodaten zur Aufklärung eines mutmaßlichen Geldwäsche- oder anderen Vermögensdelikts; beide könnten ihrerseits schwerer wiegen als etwa die massenhafte, potenziell Hunderttausende betreffende Verkehrsüberwachung mittels nummernbasierter Abschnittskontrolle. Als entscheidende Parameter müssen sowohl die verfassungsrechtliche als auch die empirische Eingriffsintensität berücksichtigt und zueinander ins Verhältnis gesetzt werden.
In dem explorativen Forschungsprojekt soll der Versuch unternommen werden, den verfassungsrechtlichen Topos der Überwachungsgesamtrechnung zu operationalisieren und Wege aufzuzeigen, wie die reale Überwachungslast, der die Bürgerinnen und Bürger ausgesetzt sind, sinnvoll erfasst und quantifiziert werden kann.
Das vollständige Dokument können Sie hier herunterladen: https://csl.mpg.de/de/aktuelles/
ueberwachung-messbar-machen/












