„Elementare Kenntnisse fehlen“ - vfdb-Präsident fordert umfassendes Gesamtkonzept



Einrichtungen des Gesundheitswesens stehen gerade jetzt besonders im Fokus. Die meisten Brände, auch im Pflegebereich, entstehen durch technische Defekte, Unachtsamkeit bei Baumaßnahmen und Renovierungsarbeiten sowie Brandstiftung. Um sie zu verhüten, bedarf es eines umfassenden Brandschutzkonzepts. Aber zur Brandverhütung sollten auch die Einbeziehung der Nachbarschaft sowie die Schulung der Patienten bzw. Bewohner gehören. GIT SICHERHEIT befragte dazu Dirk Aschenbrenner, Präsident der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb).
Herr Aschenbrenner, Brandschutz für Pflegeheime hat seine speziellen Herausforderungen. Was steht hier aus Ihrer Erfahrung heraus im Vordergrund?
Dirk Aschenbrenner: Lassen Sie mich die Frage noch erweitern: Die besonderen Herausforderungen betreffen Pflegeheime ebenso wie Krankenhäuser. Dazu führt der Bundesverband Technischer Brandschutz (bvfa), eines unserer Mitgliedsunternehmen, eine Statistik. Demnach gab es allein im vergangenen Jahr 52 Klinikbrände, bei denen sieben Menschen getötet und 111 verletzt wurden. Nach den Erfahrungen entstehen die meisten Brände durch technische Defekte, Unachtsamkeit bei Baumaßnahmen und Renovierungsarbeiten sowie Brandstiftung. Wichtig ist eine Gesamtkonzeption. Auf der einen Seite muss alles dafür getan werden, die Entstehung eines Brandes zu verhüten. Der bauliche Brandschutz muss darüber hinaus sicherstellen, dass sich Feuer und Rauch aus Zimmern, in denen sich zu pflegende Patienten aufhalten, nicht schnell auf danebenliegende Zimmer ausbreiten können. Das Dritte ist, dass eine permanente Überwachung durch Brandmeldetechnik erfolgt, die auf der einen Seite die betroffenen Personen in dem Zimmer und zugleich auch Pflegekräfte alarmiert, die zur Hilfe kommen können und natürlich auch eine Sofortalarmierung der Feuerwehr durchführt. Die vierte Komponente sind die Pflegekräfte, die zwingend erforderlich sind, um Menschen, die sich nicht mehr selbst retten können, zu unterstützen. Auch gehört dazu eine Sicherung auf der entsprechenden Etage und eine Einweisung der Feuerwehr. Wenn all diese Komponenten ineinandergreifen, hat man eigentlich ein recht rundes und funktionierendes Brandschutzsystem.
Wie kann der Brandschutz demenzkranke, nicht mobile und in ihren Sinneswahrnehmungen eingeschränkte Bewohner am besten einbeziehen?
Dirk Aschenbrenner: Bei diesem Thema müssen wir sicherlich unsere heutigen Konzepte überprüfen und das Ganze neu denken. Fakt ist auch heute schon, dass etwa zwei Drittel der Brandopfer älter als 60 Jahre sind. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass vom 60. Lebensjahr an gewisse Einschränkungen beginnen, die mit zunehmendem Lebensalter natürlich weiter voranschreiten. Das kann bedeuten, dass man zum Beispiel schlechter hört, schlechter sieht, sich schlechter bewegen kann. Und das kann bei bestimmten Krankheitsbildern dazu führen, dass die Sensibilität nachlässt. Dementsprechend müssen Brandschutzkonzepte dazu beitragen, Brände zu verhüten. Es gibt mittlerweile Technologien, die beispielsweise einen Herd abschalten, wenn eine gefährliche Situation entsteht. Ich halte auch präventive Maßnahmen wie Schulungen von Senioren für sehr wichtig, um sie mit den Brandschutzkonzepten und richtigem Verhalten zu konfrontieren. Weiter muss die Brandmeldetechnik so beschaffen sein, dass man sie auch wahrnehmen kann. Wenn ich schwerhörig bin, habe ich vielleicht ein Problem, Rauchmelder zu hören. Also muss es auch noch eine optische Alarmierung geben. Außerdem kann es auch nach der Alarmierung für jemanden, der nicht mehr mobil ist, problematisch sein, aus seiner Wohnung überhaupt zum ersten oder zweiten Rettungsweg zu kommen. Auch da ist zu überlegen, ob die Digitalisierung nicht Chancen bietet, Rauchmelder beispielsweise mit Smartphones zu verbinden, sodass auch dem Nachbarn die Alarmierung angezeigt wird. Auf diese Weise könnte außerhalb der Pflegeeinrichtung auch eine nachbarschaftliche Hilfe organisiert werden.
Stichwort barrierefreies Bauen: Das dürfte der Feuerwehr ja eher nutzen?
Dirk Aschenbrenner: Grundsätzlich ist natürlich Barrierefreiheit etwas, was auch den Rettungsbemühungen der Feuerwehr entgegenkommt bzw. eine Eigenrettung deutlich leichter möglich macht, als wenn Barrieren bestehen. Der Zielkonflikt liegt, glaube ich, im wesentlichen darin, dass man zum einen sehr viele Bestandsobjekte hat und so Barrierefreiheit schwer zu realisieren ist – und zum anderen, dass viele Möglichkeiten der Barrierefreiheit noch gar nicht in geltendes Recht bzw. den Stand der Technik umgesetzt sind. Außerdem ist es letztendlich ein Mehraufwand, der finanziell gestemmt werden muss. Ich glaube, das ist mit die größte Hürde, die genommen werden muss, um barrierefreie Rettungswege zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen.
Welche Lösungsansätze sind hier aus Ihrer Sicht die wichtigsten?
Dirk Aschenbrenner: Neben den möglichen baulichen Veränderungen, wo ich allerdings die Wirkungsgrade für relativ überschaubar halte, weil wir einfach einen sehr großen Bestand haben und vieles nur bei Neubauten oder sehr großen Umbauten realisieren könnten, halte ich es den Einbau moderner Technologien in die Rettungskette für wichtig. Ich meine damit zum Beispiel Technologien, die durch eine aktive Herdkontrolle vermeiden, dass es überhaupt zur Brandentstehung auf dem Herd kommt. Hier entstehen nämlich 40 Prozent aller Wohnungsbrände. Das könnte man reduzieren. Dann ist es wichtig, die Alarmierungstechnik so zu gestalten, dass sie auch wahrgenommen wird. Gegebenenfalls muss sie mit Informationsmedien gekoppelt werden, sodass man nach dem Prinzip „der helfende Nachbar“ aus der Wohnung heraus eine Alarmierung auslöst, die dann gegebenenfalls direkt zur Feuerwehr geht oder aber zum Nachbarn. Damit kann innerhalb des Zeitfensters der Selbstrettung eine Unterstützung erfolgen – und die betreffende Person kann in den sicheren Bereich gebracht werden. Wenn es um den Brandschutz in Wohn- und Pflegeheimen geht, so sollte im Rahmen der Möglichkeiten auch eine Aufklärung der Bewohner über richtiges Verhalten in einem eventuellen Brandfall nicht vergessen werden. Übrigens hat der gemeinsame Ausschuss für Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung von vfdb und DFV kürzlich ein Merkblatt zur Brandschutzaufklärung herausgegeben. Denn wir stellen immer wieder fest, dass überall in der Bevölkerung elementare Kenntnisse zum Verhalten bei einem Brand fehlen.
Business Partner

vfdb - Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.Postfach 4967
48028 Münster
Deutschland
Meist gelesen

Schließanlagenplanung mit dem Master Key Planner von Dom
Der Dom Master Key Planner vereinfacht den gesamten Prozess der Schließanlagenplanung deutlich. Sowohl die Bestellabläufe als auch die Schließplan-Codierung können damit effizient und strukturiert durchgeführt werden.

Sicherheit im Ernstfall: Wie Unternehmen mit strategischem Personenschutz und Amokprävention Verantwortung übernehmen
Personenschutz & Amokprävention: Strategische Konzepte, Training & Verantwortung für Unternehmenssicherheit
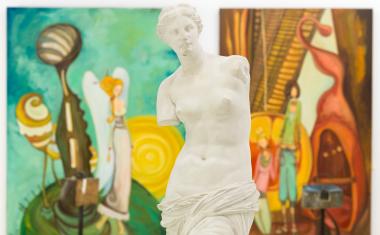
Videoüberwachung im Museum: Datenschutz und Kameraauswahl
Sicherheit für Kulturgüter ist - auch angesichts des Diebstahls im Pariser Louvre - ein wichtiges Thema. Von großer Bedeutung: die Überwachung mittels Videotechnik. Ein Beitrag darüber, was dabei zu beachten ist.

Neubau der JVA Münster: BLB NRW setzt neue Maßstäbe für Sicherheit, Resozialisierung und moderne Haftanstalten
Neubau der JVA Münster: Moderne Haftanstalt mit Fokus auf Sicherheit, Resozialisierung und Humanität

GIT SICHERHEIT AWARD 2026 – Die Gewinner stehen fest!
GIT SICHERHEIT AWARD 2026: Die besten Sicherheitslösungen des Jahres – jetzt alle Gewinner im Überblick





